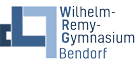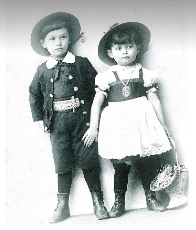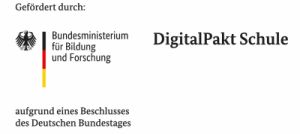16. Mai – Geburtstag des Dichters Jakob van Hoddis
Aufstieg und Fall eines Dichters
 Jakob van Hoddis spielte eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des literarischen Expressionismus und leistete einen großen Beitrag zur künstlerischen Landschaft vor und während des Ersten Weltkrieges. Er gilt als einer der wichtigsten Expressionisten überhaupt!
Jakob van Hoddis spielte eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des literarischen Expressionismus und leistete einen großen Beitrag zur künstlerischen Landschaft vor und während des Ersten Weltkrieges. Er gilt als einer der wichtigsten Expressionisten überhaupt!
In allen verbreiteten Deutschbüchern fällt sein Name, sobald vom Expressionismus die Rede ist. Auch in PAUL D – dem Deutschbuch, mit dem am WRG in der Oberstufe gearbeitet wird. Jakob van Hoddis verbrachte fast die letzten zehn Jahre seines Lebens in Bendorf-Sayn. Das steht nicht in PAUL D. Das wissen nur wenige. Er lebte hier seit 1933 in einer Heil- und Pflegeanstalt, bis er 1942 von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet wurde. Jakob van Hoddis litt nicht nur an einer psychischen Beeinträchtigung. Er war auch Jude.
Der Deutsch-Leistungskurs von Herrn Dr. Surall hat sich im Unterricht und an einem Studientag mit Jakob van Hoddis befasst und beschlossen, zu seinem Geburtstag an ihn zu erinnern. Das sind wir ihm gerade in Bendorf schuldig.
Glorreicher Bildungsweg?
Am 16. Mai 1887 wurde der jüdische Dichter und Schriftsteller Jakob van Hoddis als ältestes von fünf Kindern in Berlin geboren. Sein richtiger Name war Hans Davidsohn. Jakob van Hoddis ist ein Künstlername, den er später annahm. Er wuchs in einem überbevölkerten Viertel auf, in dem vor allem die Arbeiterschaft lebte. Zu seinem Vater Hermann Davidsohn hatte er ein schlechtes Verhältnis, da dieser sich aufgrund eigener Probleme kaum um seine Kinder kümmerte. Die Beziehung zu seiner Mutter Doris Kempner war ebenfalls schwierig. Später litt er an starken psychischen Problemen und distanzierte sich deshalb radikal von Freunden und Familie.
Hans Davidsohn wurde bereits während seiner Schulzeit wegen seines Aussehens gehänselt. Zu seinen Lehrern hatte er meist ein schlechtes Verhältnis, was sich auch in dem Gedicht „Der Oberlehrer“ widerspiegelt. Er galt als „schlau, aber faul“. Denn schon damals schrieb er eigene Gedichte, die jedoch im Gegensatz zu seiner späteren Arbeit noch eine geringere Qualität hatten. Die Schule brach er noch vor dem Abitur ab, holte es aber privat nach. 1906 begann er ein Architekturstudium in Berlin-Charlottenburg, wechselte dann allerdings nach Jena zu Philologie und Philosophie. Nach einem Semester kehrte er nach Berlin für ein Altphilologie-Studium zurück. 1911 flog Hans Davidsohn wegen Faulheit von der Uni. Außerdem trat er 1906 der „Freien Wissenschaftlichen Vereinigung“ bei, jedoch gefiel es ihm dort nicht. Deswegen gründete er mit seinen Freunden den „Neuen Club“. Dieser veranstaltete das „Neopathetische Cabaret“, welches Davidsohn bis 1911 leitete. Dort trafen sich Gleichgesinnte und trugen Gedichte vor. In dieser Lebensphase nahm er auch den Namen Jakob van Hoddis an, indem er die Buchstaben seines Nachnamens umstellte.
Schwarzes Haar und Schaum vor dem Mund
Der zeitgenössische Maler Ludwig Meidner besitzt folgendes Bild von van Hoddis: Für ihn sah Hoddis aus wie ein Südländer, welcher nicht allzu groß gewachsen war, über schwarzgelocktes Haar verfügte und nervöse, zittrige Hände besaß. Zudem zeichnete Hoddis sich durch seinen Lebensstil aus. Er lebte intensiv und hatte ein außerordentliches Temperament. Dementsprechend lehnte van Hoddis auch alles entschieden und konsequent ab, was ihm nicht passte, und wurde so durch seine Emotionalität gekennzeichnet. Zudem wurde Hoddis vollständig von seiner Dichtung in Anspruch genommen. Wenn er gedichtet hat, hat sich dies auch körperlich gezeigt, sodass er dann mit Schaum vor dem Mund zitterte.
Literarische Blütezeit
Die Mitglieder des Neuen Clubs traten zu Beginn des Jahres 1910 in der Öffentlichkeit auf. Van Hoddis stellte seinen literarisch Gleichgesinnten dafür Räumlichkeiten zur Verfügung. Er hatte die Hoffnung, dass der Neue Club historisch relevant wird, und verfolgte damit eine eher egoistische Intention. Er las im Anschluss an das Clubmitglied Loewenson sein Gedicht „Tristitia ante“ vor, mit welchem er die für ihn nun feindlichen Erlebnissphären „Nacht“ und „Stadt“ charakterisierte: Zwischen der grell erleuchteten Großstadt, ihrem gleißenden Lärm und ihrer Totenstarre entwickelt sich ein schauderhafter Sog, welcher in die kalte Fremde lockt.
Jakob van Hoddis brach dann am 5. April 1910 nach Italien auf. Seine Reise stellte anders als bei Goethe kein Bildungserlebnis dar, sondern diente vielmehr der Provokation und der Selbstdarstellung. Inspiriert von den Philosophen Nietzsche und Schopenhauer betonte er das Leben jenseits äußerer Formen. Van Hoddis‘ Werk und Haltung waren Teil eines kulturellen Kampfes, der sich gegen das Klassische und die Ideale der bürgerlichen Kultur wandte. Er und seine Zeitgenossen des Neuen Clubs veralberten etablierte Dichter wie Goethe, um die Entfremdung von der traditionellen Kultur und die Suche nach einer neuen Freiheit und Offenheit zu betonen. Ab 1910 lebte Jakob van Hoddis in der Großstadt Berlin und wurde von anderen Künstlern, die ihn kannten, als “Stadt-Verzückter” bezeichnet, da ihn die Stadt mit ihren Fortschritten und besonderen Eigenschaften faszinierte. Deshalb wurden einige seiner Gedichte maßgeblich von seinem Aufenthalt in der Großstadt beeinflusst. Zudem traf sich van Hoddis oft auch mit anderen Künstlern in den Cafés von Berlin.
Top of the Charts: „Weltende“
Als Jakob van Hoddis sein berühmtestes Gedicht „Weltende“ am 11. Januar 1911 veröffentlichte, konnte man dem scheinhaft herrschenden Frieden nicht trauen. Das Bewusstsein einer allgemeinen Krise hatten alle Neopathetiker gemeinsam, und böse Ahnungen sprachen aus ihren Versen und Bildern. Van Hoddis’ Gedicht „Weltende“ traf mit seinen acht Versen den Nerv der Zeit jedoch am empfindlichsten. Der Dichter Johannes Becher beschreibt, dass das Gedicht eine prägende Wirkung auf ihn und seine Generation hatte.
Er berichtet, dass die Zeilen die Jugendliche in eine neue Realität entführten und dass sie ihnen ein Gefühl von Überlegenheit und Freiheit vermittelten, indem sie die bestehende Welt der Langeweile und Verachtung überwanden.
Van Hoddis, welcher Homer als Vorbild hatte, wollte Welt gewinnen. Dies versuchte er mithilfe der Gleichzeitigkeit des Geschehens. Das Ergebnis dieses Versuchs ist „Weltende“, welches gleichzeitig die Welt und die Wirklichkeit zerstört und veranschaulicht. Im Gegensatz zu anderen erlebte er diese Absurdität wirklich und sah sein Gedicht als sein persönliches Scheitern an. Viele Zeitgenossen waren von diesem Gedicht tief beeindruckt.
Van Hoddis‘ Porträt wurde in der Zeitschrift „Aktion“ veröffentlicht und verkörperte die rebellische Energie der jungen Generation. Seine Gedichte wurden als Ausdruck des inneren Kampfes und der zerrütteten Psyche betrachtet und von vielen Künstlern geschätzt. Seine Werke vermittelten eine Atmosphäre der Verzweiflung und des Wahnsinns, die typisch für expressionistische Kunst ist. Es ist eine Art künstlerischer Protest, die traditionellen Werte zu zerstören und neue zu erschaffen.
Van Hoddis, der nun zu einer zentralen Gestalt geworden war, war weiterhin Teil des Neuen Clubs. Der Präsident des Clubs, Dr. Kurt Hiller, empfand ein großes Missbehagen gegenüber van Hoddis. Dieses führte zu Spannungen innerhalb des Clubs. Nachdem van Hoddis seine übel gemischten Gefühle gegenüber Hiller in Mordphantasien und Bildern des Ekels darstellte, versuchte er mehrmals, Hiller aus seinem Amt zu entfernen. Dies gelang ihm im März 1911. Danach wandte sich van Hoddis jedoch vom Neuen Club ab, isolierte sich und nahm eine unabhängige Haltung ein.
Der Anfang vom Ende
Beschäftigt man sich mit Jakob van Hoddis, so fällt einem schnell auf, dass er psychisch stark belastet war. Einen eindeutigen Auslöser gibt es dabei nicht. Denn van Hoddis‘ Leben war von vielen Schicksalsschlägen gekennzeichnet.
Der Tod von zwei ihm nahestehenden Personen, seinem Vater sowie von seinem Freund und Konkurrenten Georg Heym, war möglicherweise Auslöser seiner Psychose. Inzwischen glaubte van Hoddis Anzeichen dafür wahrzunehmen, dass seine Mutter auch schon seinen Vater wahnsinnig gemacht haben sollte. Gleiches versuchte sie seiner Meinung nach auch bei ihm. Gegenüber seiner Mutter wurde er darüber hinaus aggressiv und fühlte sein Erbe bedroht. Abschließend sprach er in einem respektlosen Ton ihr gegenüber. In seinem Leben spielten zwei Frauen, Lotte Pritzel und Emmy Hennings, eine wichtige Rolle. Lotte konnte seine Liebe nicht erwidern, sodass van Hoddis sich selbst zum Objekt seiner Geliebten machte. Er bezeichnete sich selbst sogar als „Lotte-Pritzel-Puppe“. Emmy war für ihn eine wichtige Bezugsperson, zu der er floh, wenn ihm wieder mal alles zu viel wurde. Vermutungen zufolge war Emmy Hennings ein wichtiger Grund für seine Hinwendung zur Religion oder drängte ihn womöglich sogar dazu, sich zum Katholizismus zu bekehren. Sein Leiden unter einer Neurose war das erste eindeutige Anzeichen für seine psychischen Probleme. Darüber hinaus schwächte sich durch seine Hoffnungslosigkeit, mit der er keine Besserung seiner Situation für möglich hielt, sein Glaube an Gott deutlich ab. Trotzdem konnte er den Glauben an Gott nie loslassen, doch seine Zuwendung sowie sein Glaube schwankten stark. Deutlich wird dies beispielsweise an Zeichnungen mit dem Kreuzsymbol.
Seine radikale Hinwendung zur Kunst und die psychischen Veränderungen hatten zur Folge,
dass sich sein Äußeres stark veränderte. Sein geringes Hygienebewusstsein führte dazu, dass
er sich kaum rasierte, nachlässig kleidete und seine Kleidung selten wechselte. Diese Veränderungen wurden auch von seinem Umfeld wahrgenommen. Sein Onkel beschrieb van
Hoddis als zerlumpt, ungepflegt und ausgehungert. Seine Augen deuteten einen abwesenden Zustand an, seine Sprache war stockend und seine Gedankengänge oft unzusammenhängend und abgebrochen. Van Hoddis verbrachte seine Nächte sitzend neben seinem Bett, ohne dieses zu berühren. Oft verließ er abrupt das Zimmer. In Gesellschaft schwieg er meist. Da er in seiner Vergangenheit häufig Situationen mit tödlicher Bedrohung erlebte, war sein Leben seitdem von Angst geprägt. Diese Angst versuchte er in seinen Gedichten zu verarbeiten. Seine gesellschaftlichen Vorstellungen spiegelten sich ebenfalls in seinen Texten wider, da ihn die Geschehnisse seiner Zeit stark belasteten.
Obwohl van Hoddis bereits zuvor eine Kur besucht hatte, verschlimmerte sich sein Zustand und führte zu Halluzinationen und einem Identitätsverlust. Sein Leben wurde für ihn immer mehr zur Qual, sodass zunächst seine Mutter die Vormundschaft für ihn übernahm und ihn
1922 in die Universitäts- und Nervenklinik Tübingen einweisen ließ.
In der Tübinger Nervenklinik verbrachte er nach 1922 fünf Jahre. Man diagnostizierte eine schwere Form der Schizophrenie, die als „Hebephrenie“ bezeichnet wird. Deshalb unterzog man ihn einer Reihe von klinischen Therapien und Behandlungen, die jedoch nur begrenzten
Erfolg zeigten. Während dieser Zeit zeigte van Hoddis auffällige Verhaltensweisen, darunter das Sammeln von Zigaretten und Papierfetzen, das Zeichnen von Bildern und das wahllose Ansägen von Gegenständen. Trotz einiger skandalöser Ausbrüche galt er größtenteils als ungefährlich.
Sein Zustand verschlechterte sich weiter, und er wurde schließlich nach Göppingen in das Christophsbad verlegt. Dort setzten sich seine ungewöhnlichen Verhaltensweisen fort, begleitet von Desinteresse an seiner Umwelt und sozialer Isolation. Die Kommunikation mit seiner Familie wurde immer schwieriger, da er sich zunehmend zurückzog. Später übertrug seine Mutter die Vormundschaft auf ihren Bruder, da sie Deutschland aufgrund ihrer jüdischen Herkunft verlassen musste.
Düstere Zeiten: Jacobysche Heilanstalt Bendorf-Sayn
 Im Jahre 1933 wurde van Hoddis kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die Israelitische Heil- und Pflegeanstalt nach Bendorf-Sayn gebracht. Dort verbrachte er die letzten neun Jahre seines Lebens. Diese Einrichtung war für jüdische Nerven- und Geisteskranke bestimmt und bot einen gewissen Grad an Ruhe und religiöser Unterstützung. Doch auch hier wurde die Ruhe bald durch die Machtergreifung der Nazis gestört, und aufgrund seiner jüdischen Abstammung und geistigen Einschränkung geriet van Hoddis in deren Visier.
Im Jahre 1933 wurde van Hoddis kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die Israelitische Heil- und Pflegeanstalt nach Bendorf-Sayn gebracht. Dort verbrachte er die letzten neun Jahre seines Lebens. Diese Einrichtung war für jüdische Nerven- und Geisteskranke bestimmt und bot einen gewissen Grad an Ruhe und religiöser Unterstützung. Doch auch hier wurde die Ruhe bald durch die Machtergreifung der Nazis gestört, und aufgrund seiner jüdischen Abstammung und geistigen Einschränkung geriet van Hoddis in deren Visier.
Zunächst jedoch blieb van Hoddis trotz der rücksichtslosen und oft brutalen Methoden, die von der nationalsozialistischen Regierung zu dieser Zeit angewendet wurden, größtenteils von schlimmen Maßnahmen verschont.
Im Jahr 1942 war allerdings jegliche Schonung zu Ende: Jakob van Hoddis wurde vom Bahnhof Sayn aus mit dem Zug nach Osten deportiert und wahrscheinlich in einem Vernichtungslager ermordet. Die Deportationsliste von Bendorf-Sayn ist das letzte Lebenszeugnis, das wir von ihm haben.
Trotz seiner psychischen Erkrankung und seiner Ermordung durch die Nazis blieb van Hoddis‘ Erbe in der Welt von Literatur und Kunst lebendig. Sein Einfluss auf nachfolgende Generationen von Dichtern und Künstlern war unbestreitbar.
Fazit: Jakob van Hoddis und wir
Die Geschichte von Jakob van Hoddis ist ein trauriges Zeugnis für die Grausamkeit und das Leiden, das viele während der nationalsozialistischen Ära erlebten. Trotz seiner künstlerischen Begabung und seines Potenzials wurde sein Leben von einer schweren psychischen Erkrankung und den Umständen seiner Zeit überschattet. Sein Schicksal erinnert uns daran, die Opfer des Holocausts niemals zu vergessen und uns weiterhin für Toleranz, Mitgefühl und Gerechtigkeit einzusetzen. Es ist eine Erinnerung an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, ja der Menschheitsgeschichte. Verbunden mit dieser Erinnerung ist die Notwendigkeit, aus der Vergangenheit zu lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Der Geburtstag Jakob van Hoddis‘ am 16. Mai sollte daher jedes Jahr aufs Neue ein Anlass sein, diese Erinnerung wach zu halten – nicht nur, aber besonders in Bendorf, von wo aus er seine letzte, schreckliche Reise antrat.
( – LK Deutsch Jgst 13 (Abi 2024) / Dr. F. Surall –)